Vierte KlimAKonferenz der BBH-Gruppe: Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Klimaschutz – ist der Neustart der Energiewende geglückt?
Am 12. November fand in Berlin die vierte KlimAKonferenz der BBH-Gruppe statt. Mit einem Blick auf die Klimawende im internationalen Kontext am Vorabend der Konferenz gab Dr. Friedbert Pflüger, Geschäftsführer der Denkfabrik Clean Energy Forum, den Anstoß für erste Gedanken und Gespräche.
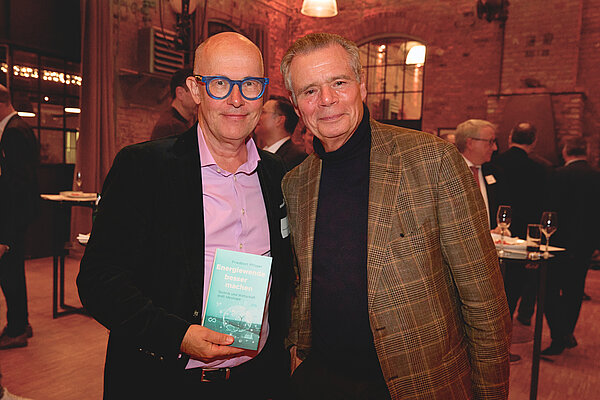
Am Konferenztag begrüßte BBH-Partner und Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Theobald die Gäste auf dem EUREF-Campus, „einem Zukunftsort, auf dem mehr als 150 Unternehmen, Institutionen und Start-ups rund um die Themenfelder Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit“ arbeiten und seit 2014 aktiv zum Erreichen der Klimaziele beitragen. In diesem inspirierenden Umfeld ging es um die Frage, wie Klimaschutz, Versorgungssicherheit, Finanzierung und Transformationsgeschwindigkeit miteinander vereinbar sind.

Gastgeber Prof. Dr. Christian Theobald mahnte, dass Klimaschutz angesichts der geopolitischen Lage zumindest in der Wahrnehmung nach hinten gerutscht sei. Er dürfe jedoch auf der politischen Agenda nicht an Bedeutung verlieren. "Die Hände in den Schoß zu legen, wäre fatal.” Wie bei einem Marathon, bei dem sich Läufer:innen die lange Strecke in mehrere Abschnitte einteilen, wäre das auch beim Klimaschutz nötig. Über diese einzelnen Schritte wurde gesprochen und einzelne Projekte – erfolgreiche und weniger erfolgreiche – unter die Lupe genommen. Denn es geht darum, Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen und gegebenenfalls ein paar Schritte auf einmal gehen zu können.

Im ersten Impuls zur aktuellen Klimaschutzpolitik aus kommunaler Sicht und dem „Herbst der Reformen“ fragte Dr. Christine Wilcken, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetags, wie viel Ordnungspolitik der Klimaschutz tatsächlich brauche und welche Rahmenbedingungen Kommunen langfristig handlungsfähig machten. Die Lage sei dramatisch. Nur wenige Kommunen haben einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Sie erledigen „ein Viertel aller Aufgaben, während sie nur ein Siebtel aller staatlichen Einnahmen erhalten“. Diese Schere bremst Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur spürbar aus. Die 100 Milliarden Euro aus dem neuen Sondervermögen müssten spürbar bei den Kommunen ankommen. Investitionssicherheit, Klarheit und Feintuning: Für Städte, die in acht Monaten einen kommunalen Wärmeplan vorlegen müssen, sei ein verlässlicher regulatorischer Rahmen wichtig.

Anschließend stellte Dr. Felix Matthes, Forschungskoordinator beim Öko-Institut e. V., klar: „Die Energiewirtschaft ist auf Kurs.“ Wir kämen jedoch in eine neue Phase. „Klimaschutzpolitik wird künftig eine Diskussion über die Netzkosten sein.“ Nicht die Erzeugungskapazitäten, sondern die Leitungsinfrastrukturen werden zum neuen Hotspot der Energiewende. Statt Betriebskosten machen Kapitalkosten den Hauptanteil aus. Mit Blick auf den Investitionsberg vor 2030 warnte Matthes, dass sich die Debatten um Planung, Finanzierung und Responsivität der Netze drehen müssten. Technologieoffenheit sei zudem ein wichtiger Faktor. Nur so kann die Energiewende zu „überschaubaren Kosten“ und mit breiter Akzeptanz gelingen.

BBH-Partner Tobias Sengenberger betonte, in der Diskussion fehle oft die Frage, aus welchem Geschäftsmodell so viel verdient wird, dass der Kapitaldienst bedient werden kann. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater rief die Stadtwerke dazu auf, „mit der Finanzierung der Energiewende zu beginnen, solange Sie Gewinne erzielen“. Zudem sei es wichtig zu wissen, wie Banken bei der Kreditvergabe vorgehen, wie Investitionen in erneuerbare Energien, Netze und Anlagen bewertet werden und welche Informationen im Nachhaltigkeitsbericht relevant sind. Denn es gehe für sie vor allem darum, Investitionen abzusichern. Deshalb empfahl er den Stadtwerken, mit Stakeholdern zu sprechen und ihren Bericht strukturiert aufzuarbeiten.

BBH-Partner Prof. Dr. Olaf Däuper moderierte die erste Podiums- und Plenumsdiskussion und befragte die Energieversorger nach dem Spannungsfeld von Preisgünstigkeit und Klimaschutz. Er bat um Einblicke in die Praxis. Dr. Robert Greb, der Vorstandsvorsitzende der REWAG, sagte, dies habe im Strombereich gut funktioniert. Hier wurde so finanziert, dass die Verbraucher das nicht gespürt haben. Jetzt gebe es jedoch wachsende Widerstände, da die Kosten „im Heizungskeller ankämen“. Eine konsumentennahe Kommunikation sei schon jetzt „ein Bohren dicker Bretter“. Auch einer Stadt wie Regensburg mit ausgeglichenem Haushalt werde der Umbau der Wärmenetze nur mit Fördermitteln gelingen. Falle das Gebäudeenergiegesetz (GEG) weg, würde sich der Umbau verlangsamen, was in Kombination mit der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie eine große Herausforderung darstellen würde. Zudem werden Maßnahmen zur Klimaanpassung, etwa bei der Trinkwasserversorgung, immer wichtiger.


Geschäftsführerin Anja Lemke, muss bei den Stadtwerken Sondershausen GmbH, wie viele andere ein Fernwärmenetz, das auf Erdgasversorgung beruht, umstellen. Sie sieht neben der Investitionslast das Risiko einer Versorgungslücke. Ihr Vorteil ist, dass die Gesellschafter auf ihrer Seite stehen. Dr. Robert Greb stimmt für Regensburg zu, dass auch dort Verständnis dafür besteht, dass Gewinne thesauriert werden. In Thüringen sind die Stadtwerke zudem gut vernetzt und gehen mit Kooperationen Dinge gemeinsam an, etwa bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten, so Anja Lemke.

Stefan Gustke, Leiter des Bereichs Energie und Versorgung bei der Deutschen Kreditbank, beobachtet viele tolle Projekte, aber auch viele, die sich nicht rechnen. „Die Energiewende wird in der Stadtwerkbilanz entschieden.“ Stadtwerke hätten jedoch oft „die Handbremse angezogen, wenn es um die Finanzierung geht“. An Fremdkapital würde es nicht scheitern, es gibt genug Investoren. Wichtig sind Verlässlichkeit und eine ausgereifte Fördermittelkulisse.

Das sieht auch Tobias Sengenberger, „Wir brauchen einen stabilen politischen Rahmen, der sich nicht alle vier Jahre ändert. Es startet sonst keiner mit großen Investitionen und dem Umbau.“ Eine Unterstützung durch Landesbürgschaften, wie sie in Hannover praktiziert wird, sei ein guter Weg. Aber auch das Einsammeln von privatem Kapital, etwa über Bürgerbeteiligungen, wie Gustke ergänzt. Mit dem Stromnetz Berlin GmbH hatte Geschäftsführer Bernhard Büllmann eine Sonderrolle in der Runde inne, trivial ist der Betrieb mit 36.000 km Leitung aber nicht. Energiewende, Mobilitätswende, Dekarbonisierung und Rechenzentren treiben den Stromnetzausbau voran.

Während Dr. Robert Greb betonte, auf Sicht zu fahren, ist für Bernhard Büllmann u. a. wegen Materialknappheit jeder Tag wichtig. In den nächsten Jahren sind Planbarkeit und Finanzierbarkeit wichtige Aspekte. Für ihn widersprechen sich Preisgünstigkeit und Klimaschutz nicht. Er sieht das Stromnetz Berlin durch das Land und die beteiligten Banken gut aufgestellt. „Unser Banktreffen einmal im Jahr hat sich bewährt. Wir gehen durch technische Einrichtungen, damit greifbar wird, was man finanziert.“ Zur Akzeptanz und Einbindung der Bevölkerung gibt es einen Bürgerrat, dem die Projekte vorgestellt werden. Sie sind „Multiplikatoren, die Dinge transportieren, die uns am Herzen liegen.“
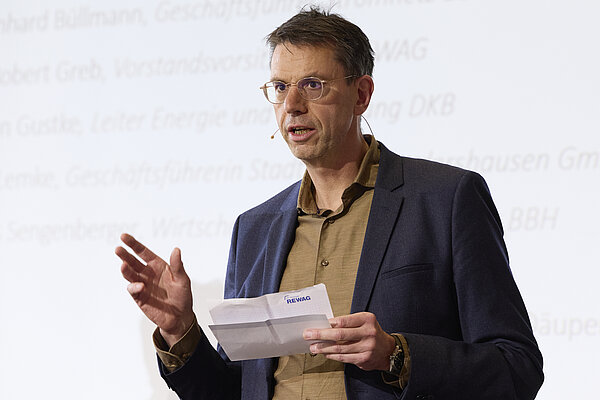
Am Nachmittag gewährte Ministerialdirektor Berthold Goeke Einblick in den „Maschinenraum“ des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Der Leiter der neu gegründeten Abteilung für nationalen und europäischen Klimaschutz bat um Vertrauen und versicherte, dass Klimaschutz „für diese Bundesregierung weiterhin eine zentrale Aufgabe bleibt“. Er stellte das neue Klimaschutzprogramm vor und hob hervor, dass erstmals die soziale Dimension aller Maßnahmen systematisch mitgedacht werde: Akzeptanz entstehe, wenn Belastungen abgefedert, Strom günstiger gemacht und Förderprogramme sozialgerecht zugeschnitten würden; genau das „wird ein Schwerpunkt des Programms“ und solle „möglichst zügig Planungssicherheit und Verlässlichkeit“ schaffen. Er betonte, dass „grüner Wasserstoff eigentlich zum entscheidenden Energieträger auf dem Weg zur Klimaneutralität in Deutschland werden“ müsse, insbesondere für die Industrie und im Zusammenspiel mit Technologien wie CCS, CCU und Kreislaufwirtschaft.

Marco Ohme, Geschäftsführer der im April gegründeten BBH Engineering GmbH, stellte das „jüngste Kind in der BBH‑Gruppe“ vor. Der Dipl.-Ing. bezeichnete das Unternehmen als wichtigen „Lückenschluss in Richtung Planung“. Er betonte, dass in den nächsten zehn Jahren vergleichbare Fortschritte wie in den vergangenen drei Jahrzehnten erreicht werden müssten und der Energiemix der Zukunft ein Zusammenspiel verschiedener Technologien sein werde. Wärmepumpen würden „im Nah‑ und Fernwärmenetz künftig als Basistechnologien fungieren“; wegen hoher technischer Reife und Skalierbarkeit eigneten sie sich für Neubau und Bestandsnetze. In Kombination mit PV, Biomasse und Geothermie seien lokale Wertschöpfung und regionale Energieautarkie überzeugende Argumente. Als Herausforderungen nannte er regulatorische Unsicherheiten, Genehmigungsverfahren und lange Planungszeiten, insbesondere in dicht bebauten Gebieten.

BBH‑Partner Counsel und Rechtsanwalt Dr. Holger Hoch sprach über die „Stadtwerke der Zukunft“ als Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels und räumte ein: „Ich habe auch nicht die Glaskugel, die sie alle benötigen.“ Er stellte heraus, dass Stadtwerke heute ein großes Aufgabenspektrum tragen, was sich etwa an der neuen Gasverteilnetz‑Entwicklungsplanung (RefE‑EnWG) zeige. Zugleich beobachtet er eine stärkere Belastung bestehender Gesetze, etwa durch die nun verbindlichere Wärmeplanung. Ziel sei die Dekarbonisierung bis 2045, die Umsetzung falle jedoch sehr unterschiedlich aus. Entscheidend sei die Verbindung von Systemsicht und kaufmännischer Perspektive innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen; es gehe um praktikable Lösungen und die (Fettes Brot-) Frage „Darf ich‘s machen oder lass ich‘s lieber sein.“

Moderiert von BBH‑Partner Dipl.-Ing. Peter Bergmann diskutierten Prof. Dr.‑Ing. Kathrin Goldammer, Janice Kaiser, Lars Prahler und Heike Witzel im zweiten Panel, wie Stadtwerke die Wärmewende unter realen betrieblichen Bedingungen bewältigen und welche Voraussetzungen dafür nötig sind. Heike Witzel, Vorständin der Stadtwerke Rostock AG, sagte, das Haupthemmnis liege nicht in Technologie oder Finanzierung, sondern in der Verwaltung: Rund 100 Millionen Euro aus BEW‑Modul II erzeugten enormen Fristendruck, weil Vorarbeiten zuvor nicht möglich gewesen seien; zusätzlich bestehe eine erhebliche Bürokratiebelastung, etwa durch mehrfach geforderte Papierausfertigungen.


Janice Kaiser, Geschäftsführerin der Stadtwerke Schneeberg GmbH, knüpfte an und betonte, dass stabile politische Rahmenbedingungen für kleine Stadtwerke genauso entscheidend seien wie für große: „Stadtwerke vor Ort haben einen großen Vertrauensvorschuss“, aber diesen könne man nur halten, „wenn Verlässlichkeit gegeben ist“. Andernfalls ließen sich langfristige Investitionen nicht verantworten. In Schneeberg würde man deshalb auf machbare Technologien setzen: Wasserstoff sei aufgrund der Entfernung zum Kernnetz keine Option, während die tiefe Geothermie durchaus Chancen eröffne, allerdings nur, wenn Bund und Länder die Risiken absichern.

Prof. Dr. Kathrin Goldammer, Geschäftsführerin des Reiner‑Lemoine‑Instituts und Honorarprofessorin an der HTW Berlin, betonte, dass nicht die Technologien das Problem seien, sondern die Informationsbasis, auf der Entscheidungen getroffen werden. Potenzialanalysen und valide Priorisierungen seien nur möglich, wenn umfassende Daten zu Netzen, Betriebsmitteln und Infrastrukturen vorlägen: „Wenn ich ausrechnen möchte, wie Gas- oder Stromnetze künftig aussehen sollen, helfen mir alle Datenpunkte, die Sie haben.“

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler erklärte, wie die norddeutsche Stadt die Wärmewende langfristig angeht und stellte mehrere Projekte vor, darunter das erste Energieplus‑Klärwerk Deutschlands, umfangreiche LED‑Modernisierungen, Smart‑Home‑Pilotvorhaben sowie kommunale Wind‑, PV‑ und Biogasanlagen. Er machte deutlich, dass diese Entwicklung nur möglich war, weil in Grevesmühlen „viele andere Mitstreiter seit 2003 sehr konkret an diesem Thema arbeiten“. Als zentrales Erfolgsrezept hob Prahler das lokale Netzwerk aller relevanten Akteure hervor, in dem „alle maßgeblichen Entscheidungsträger der Stadt miteinander tätig sind“.

Der Redakteur und Moderator in der ZDF‑Wetterredaktion Özden Terli schloss mit einem bildstarken Vortrag, in dem er per Videos den Fortschritt klimatischer Veränderungen zeigte und den daraus resultierenden Handlungsdruck für Energie‑ und Wärmewende betonte. Er verwies darauf, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Klimaschutz als Menschenrecht anerkenne und damit Politik und Gesellschaft verbindlich adressiere. Terli machte klar, dass Reduktionsstrategien nicht mehr ausreichten und die Klimakrise nur durch den vollständigen Verzicht auf fossile Energieträger verhindert werden könne: „Wir müssen auf null runterfahren. Wir dürfen keine Kohle, kein Öl und kein Gas mehr verbrennen.“

Nach einem intensiven Konferenztag voller Fachbeiträge und Diskussionen zog Prof. Dr. Christian Theobald ein Resümee und brachte die Leitlinie des Tages klar auf den Punkt: „Verlässlichkeit, Akzeptanz und Zusammenarbeit sind die Basis, auf der die Wärmewende gelingt“. Zum Abschluss dankte er allen Beteiligten für ihren Einsatz und die lebendige Gestaltung des Tages und lud mit den Worten die Gäste in die Skylounge des Gasometers ein.
Dr. Kai Roger Lobo, Geschäftsführer Energiewirtschaft beim Verband Kommunaler Unternehmen e.V., knüpfte in seiner Dinnerspeech noch einmal thematisch an und setzte einen präzisen Schlusspunkt: „Klimaziele sind vor allem Investitionsziele. Die Entwicklung ist technologisch getrieben. Wenn wir es nicht schaffen zu investieren, schaffen wir auch die letzten Prozente bei den Klimazielen nicht. Wir erwecken aber den Eindruck, als könnten wir den ganzen Weg nur durch Governance gehen.“

Kontakt:
KlimAK
Prof. Dr. Christian Theobald
Rechtsanwalt, Partner
Tel +49(0)30 611 28 40 - 113
christian.theobald@bbh-online.de
Prof. Dr. Ines Zenke
Rechtsanwältin, Partnerin
Tel +49 (0)30 611 28 40 - 179
ines.zenke@bbh-online.de
Prof. Dr. Olaf Däuper
Rechtsanwalt, Partner
Tel +49(0)30 611 28 40 - 15
olaf.daeuper@bbh-online.de
Dipl.-Ing. Peter Bergmann
Vorstand BBH Consulting AG
Tel +49 (0)30 611 28 40 - 919
peter.bergmann@bbh-beratung.de
Die BBH-Gruppe finden Sie im Internet unter www.die-bbh-gruppe.de, www.bbh-blog.de, x.com/BBH_online oder instagram.com/die_bbh_gruppe.
